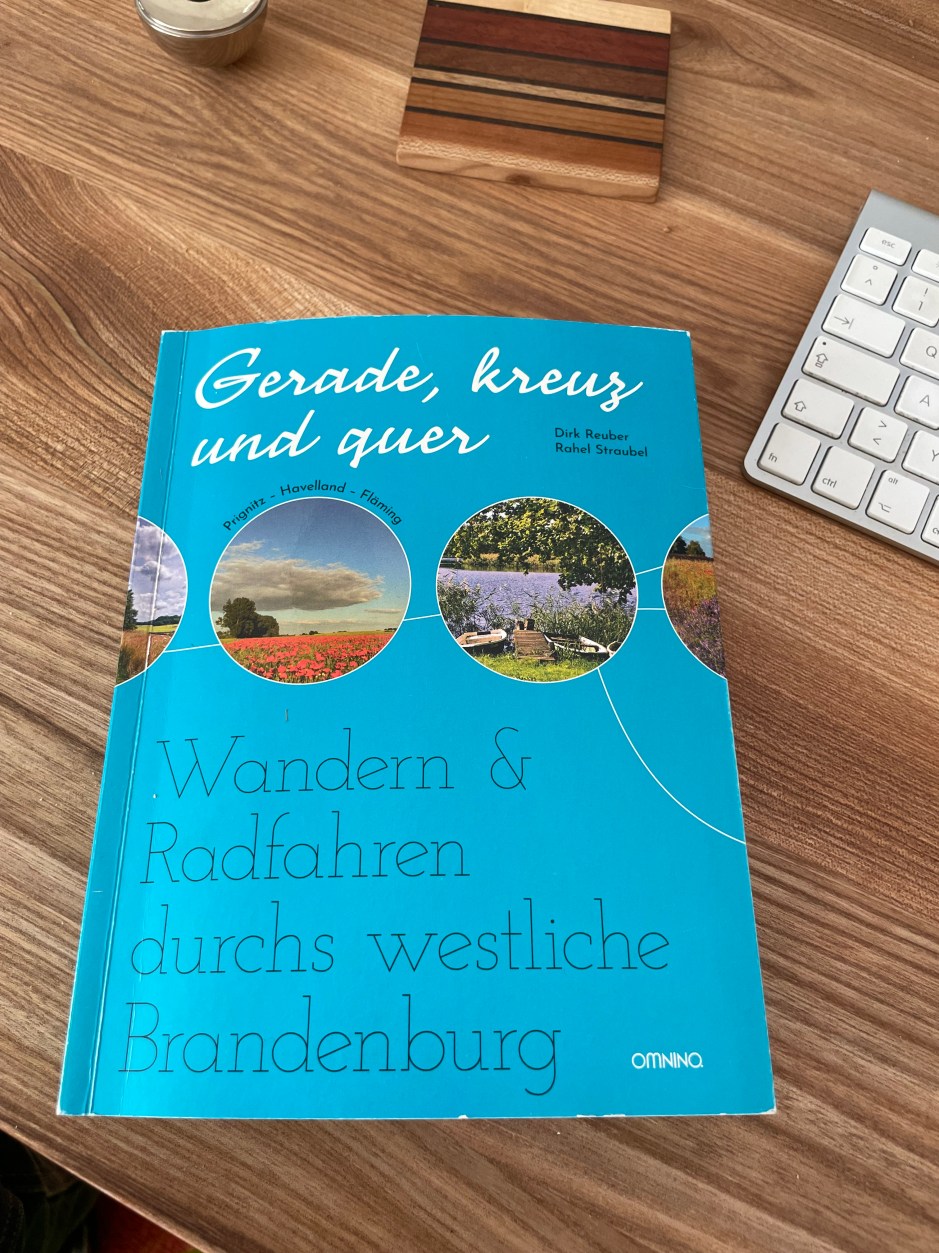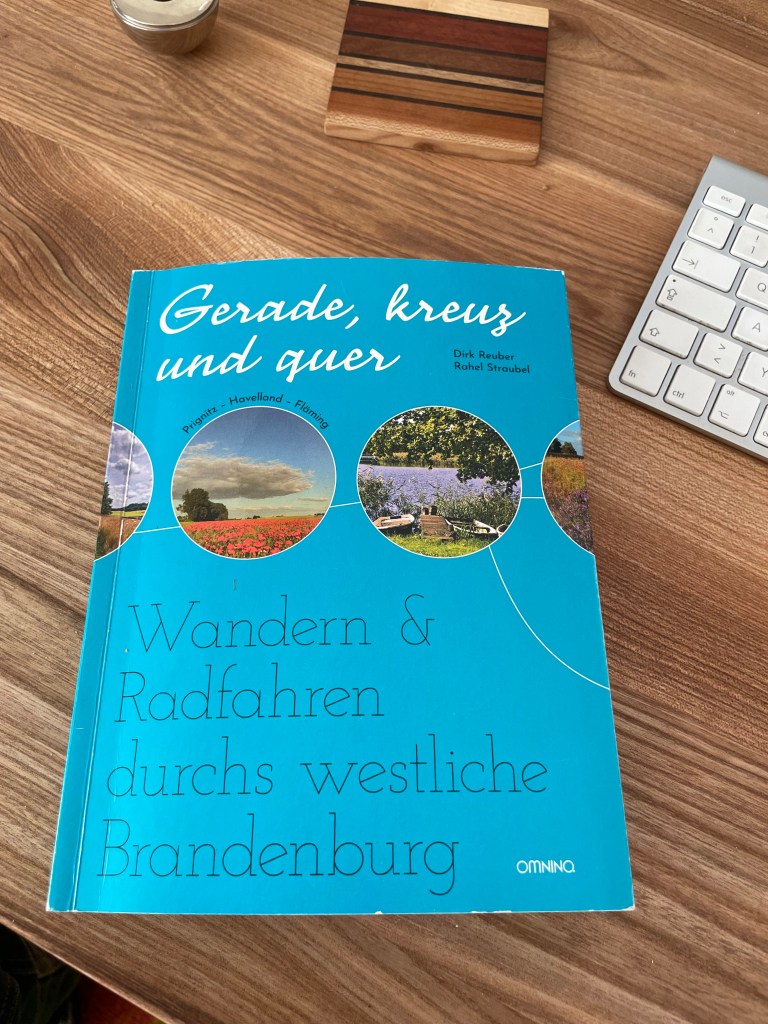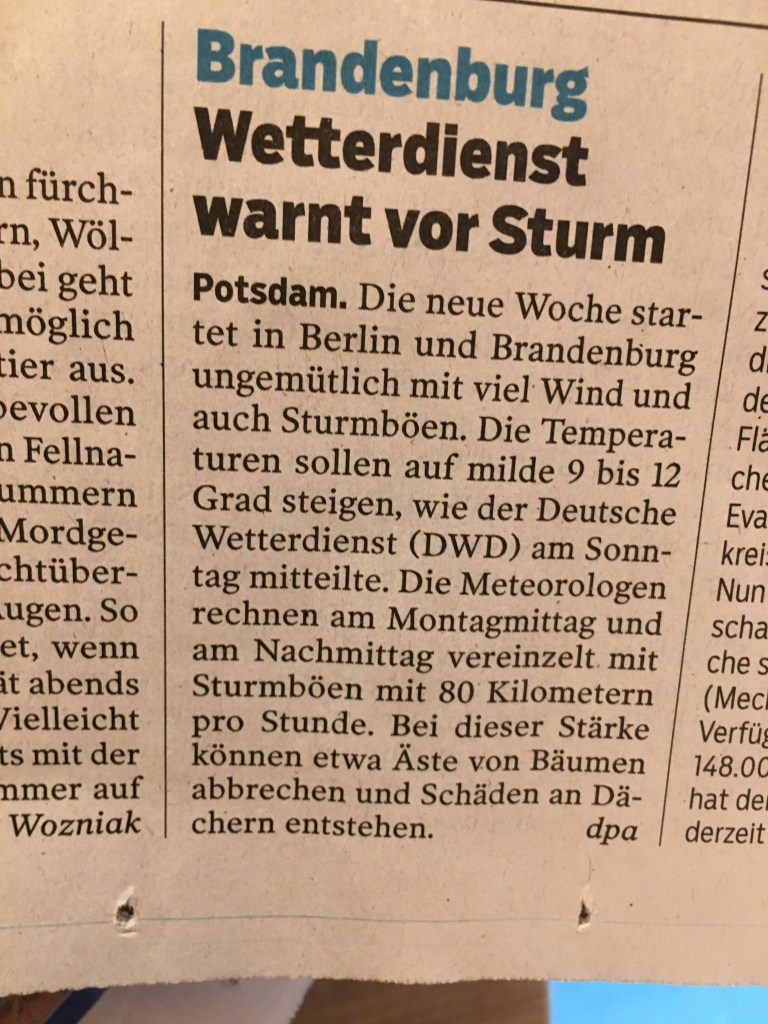1. Februar, 10.00 Uhr. Aus dem Wolkengrau macht die Sonne Himmelblau. Das Thermometer zeigt vier Grad an, mein Cannondale Taurine ist froh, dass ich es aus dem Winterschlaf wecke. Ich habe Lust auf eine kleine Fototour mittenhinein in die große Stadt. Im Zickzack rolle ich mit der Sonne im Südosten als Wegweiser. Schnell bin ich in Afrika, genauer im Afrikanischen Viertel im Wedding, wo schon 1929 die Architekten Mebes, Emmerich und Bruno Taut die Friedrich-Ebert-Siedlung entwarfen und bauten: erschwinglicher Wohnraum, modern, zeitlos. Wohnungen mit 44 bis 62 qm Fläche und mit Zentralheizung, die über Balkon oder Loggia, dazu ein Bad verfügten. Innerhalb von nur zwei Jahren Bauzeit entstanden über 1400 Wohnungen. Auch heute, fast 100 Jahre später, wirkt die klare Formensprache modern und zeitgemäß.

Ich lese die Namen Ghana-, Togo- und Swakopmunder Straße. Volkspark Rehberge, Plötzensee mit seiner unrühmlichen Geschichte, dann bin auf dem Radweg am Spandauer Schifffahrtskanal, der über den Invalidenfriedhof zum Hamburger Bahnhof, dem Hauptbahnhof, an der Charité vorbei ins Regierungsviertel führt.





Ich rolle am Hauptbahnhof und dem herrlich spiegelnden City-Cube vorbei und bin wieder einmal fasziniert von der Architektur. Start-Stopp-Foto, Start-Stopp – nächstes Motiv und so weiter. Es ist immer wieder ein Erlebnis, hier hindurchzukurven. Das Winterlicht und der dynamische Wolkenhimmel beleuchten die Szenerie filmreif. Unter den Linden tauche ich ein ins alte Berlin mit Humboldtuniversität, Oper und Berliner Dom; Friedrich der Große sitzt, den Dreispitz auf dem Kopf, den Blick nach Osten gerichtet, auf seinem Lieblingspferd Conde. Die mächtige Bronzeplastik ist ein Meisterwerk von Christian Daniel Rauch, geschaffen 1839-51.






Hier, an der Museumsinsel, an der Schlossbrücke, am Humboldtforum, ist für mich Berlin am schönsten. Also kurve ich noch ausgiebig herum und lande vor der Baustelle des Einheitsdenkmals, genannt Einheitswippe. Allein: Es wippt noch nichts! Beschlossen vor 16 Jahren, Baubeginn vor drei Jahren… Und bis heute eine Baustelle! Blamabel! Peinlich! Einfach nur übel.


2,5 Mio € fordert die Baufirma nach, weil die Kosten gestiegen seien, und der Bund tut sich offenbar schwer, Mittel nachzuschießen. Jetzt ist also Pause, bis Geld und Material kommen.

Beeindruckt von so viel Schnelligkeit und Entschlusskraft setze ich mich wieder auf mein Taurine und schaue mir die Vorderseite des Stadtschlosses und das Replikat des altindischen Sanchi-Tores an. Demnächst werde ich mir dann das Museum für Asiatische Kunst im Humboldtforum gönnen. Heute lehne ich mein Taurine vorsichtig an den Sockel und suche die beste Fotoperspektive.

Ein paar Meter weiter begrüße ich die Herren Marx und Engels auf dem gleichnamigen Forumsplatz. Gegossen in „Dünnschichtbronze“, sitzen die Erfinder des Sozialismus seit April 1986. Geschaffen vom Bildhauer Ludwig Engelhardt. Das beliebte Fotomotiv haben die Berliner prompt „Sacco und Jacketti“ getauft.

Karl Marx und Friedrich Engels schauen nach Osten, hatten also schon bei der Einweihung ihres Gedenkmonuments dem ehemaligen Palast der Republik, auch „Palazzo Prozzo“ genannt, den Rücken gekehrt.
Im Blick haben die beiden zwei überaus unterschiedliche Kunstwerke: zum einen acht Stelen aus Edelstahl mit eingeätzten Fotos – auf einem Erich Honecker inmitten freundlicher DDR-Bürger. Andere zeigen Menschen von Arbeiteraufständen auf der ganzen Welt. Daneben die Bronzereliefs “ Die Würde und Schönheit freier Menschen“ der Mecklenburgischen Künstlerin Margret Middell.



Die Doppelstelen mit dem Sichtspalt bieten sich an für Fotos durch sie hindurch mit Blick auf den Fernsehturm.
Ich nehme ein paar Schlucke aus der Trinkflasche und wecke das Taurine wieder auf. Nächste Station: Potsdamer Platz. Ein Ort, den ich vor 25 Jahren bei der Eröffnungsfeier erlebt habe, an dem ich fast 10 Jahre meines beruflichen Lebens verbracht habe, oft bis in die Nacht hinein. „Der Daimler“ war der Hauptinvestor des „Neuen Potsdamer Platzes“. Und so zog der gesamte deutsche Mercedes-Vertrieb von Stuttgart nach Berlin. Nicht alle haben sich gefreut … Heute blicke ich zurück mit etwas Wehmut auf die Zeit im Richard-Rodgers-Gebäude mit dem markanten Eckturm.

Das Arkaden-Einkaufszentrum, das sich längs zwischen den Gebäuden erstreckt, war in den 2000er Jahren ein echter Publikumsmagnet. Aus meinem Büro konnte ich hinüberschauen zum Marlene-Dietrich-Platz vorm Musical-Theater und die Berlinale-Stars auf dem roten Teppich von oben betrachten. Der Daimler hat seinen Teil des Platzes schon 2016 an einen US-Investor verkauft und ist zum Ostbahnhof umgezogen.




Der Verkehrsturm steht seit 100 Jahren am Potsdamer Platz. Als erste Verkehrsregelanlage dieser Art in Deutschland. Der Vorläufer der heutigen Ampelanlagen.
Als ich wieder gen Westen, Richtung Philharmonie vom Platz rolle, grüße ich die herrliche Skulptur „The Boxers“ von Keith Haring, die hier seit 1987 steht und immer noch leuchtet und wirkt. Bald ist wieder Berlinale, und der Platz wird sich wieder wie neu anfühlen.
Als ich den Westhafenkanal nach Norden quere, lese ich auf dem Geländer den für mich passenden Spruch des Tages: „Some souls feel each other, even miles apart“

Weiter geht es durch Schrebergartenkolonien hin zum Ex-Flughafen Berlin-Tegel



In Tegel habe ich schon oft die riesigen „Mural Art“- Hochhausmalereien fotografiert. Heute gefällt mir dieses Kunstwerk des Künstler-Teams London Police am besten: Es verströmt spontan gute Laune und bringt mich frohgemut wieder nach Hause.
Rollen, schauen, staunen, Neues entdecken, Schönes und Schauerliches sehen, zurückblicken, und dann wieder nach vorn. Dort ist die Zukunft!